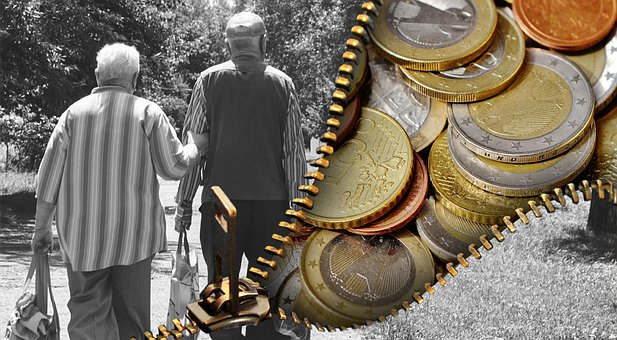- 1.Wie hoch ist der Mindesturlaub?
Schwerbehinderten steht ein Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen zu (bei Verteilung der Arbeitszeit auf mehr oder weniger als 5 Arbeitstage, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaubsanspruch entsprechend)
Da der Zusatzurlaub im SGB IX gesetzlich geregelt ist, muss er nicht explizit in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden. Ein/e Beschäftigte/r mit Schwerbehinderung kann diesen Urlaub beanspruchen – hierzu muss dem/der Arbeitgeber/in allerdings die Schwerbehinderung bekannt sein.
- 2. Möglichkeiten der Kündigung
Eine Kündigung ist nur möglich nach vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes. Die Integrationsämter sind verpflichtet, zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Schwerbehinderten abzuwägen. Sie müssen möglichst einvernehmliche Lösungen anstreben. Es ist also keine Beschäftigungsgarantie für den Schwerbehinderten. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist bei vertretbaren Gründen immer möglich. Innerhalb der ersten sechs Monate ist das Einschalten des Integrationsamtes nicht nötig, unabhängig von der vereinbarten Probezeit.
- 3. Welche Höchstarbeitszeit haben Schwerbehinderte?
Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten, arbeiten im Schicht- und Nachtdienst und leisten bei Bedarf Überstunden. Lediglich auf ihr Verlangen hin sind Schwerbehinderte von Mehrarbeit freizustellen.
- 4. Wer gilt als Schwerbehindert?
Als schwerbehindert gelten alle Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50%.
- 5. Welche finanziellen Förderungen gibt es für Schwerbehinderte?
Da die behindertengerechte Ausstattung und der Umbau eines
Arbeitsplatzes viel Geld kostet, erhalten die Arbeitgeber Zuschüsse vom
Integrationsamt bzw. der Agentur für Arbeit.
Der Arbeitgeber sollte mit dem Integrationsamt bzw. der Agentur für
Arbeit Kontakt aufnehmen und konkrete Fördermöglichkeiten erfragen.
Folgende wichtige Fördermittel gibt es:
- Zuschüsse bis zur vollen Höhe der Kosten einer behindertengerechten
Ausstattung des Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzes. Zuständig ist das
Integrationsamt.
- Zuschüsse für befristete Probebeschäftigungen von
behinderten oder schwerbehinderten Menschen (max. 3 Monate). Zuständig
ist die Agentur für Arbeit.
- Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbehinderte Menschen. Zuständig ist die Agentur für Arbeit.
Zuschüsse werden auch den Schwerbehinderten selbst gewährt. Sie können Zuschüsse für technische Arbeitshilfen sowie eine notwendige Arbeitsassistenz bekommen. Kosten für notwendige Weiterbildungen werden ebenfalls erstattet.
- 6. Was ist die Ausgleichsabgabe?
Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten müssen 5 % ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten (bzw. schwerbehinderten gleichgestellten) Beschäftigten besetzen. Wenn dies nicht geschieht, muss der Arbeitgeber eine jährliche Ausgleichszahlung an das Integrationsamt leisten.
- 7. Was ist eine „Gleichstellung“ ?
Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 %, aber mindestens 30 %, können einem schwerbehinderten gleichgestellt werden, wenn er infolge seiner Behinderung ohne die Gleichstellung einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz nicht erlangen oder behalten kann. Die Gleichstellung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit. Sie wird im Normalfall an dem Tag gültig, an der sie beantragt wird. Es gelten für Gleichgestellte die gleichen gesetzlichen Regelungen des SGB IX bis auf folgende Ausnahmen:
- Kein Anspruch auf Zusatzurlaub
- Keine unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr
- 8. Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement bei Schwerbehinderten
Hierbei unterstützt Sie das Integrationsamt. Es berät und informiert die Beteiligten um aufkommende Schwierigkeiten zu beheben. Bei Bedarf weist es auf die zuständigen Fachdienststellen oder andere Leistungsträger hin.
- 9. Was ist eine Arbeitsassistenz?
Die Arbeitsassistenz ist eine Unterstützung am Arbeitsplatz die regelmäßig und dauerhaft benötigt wird, wie z. B. Vorleser bei sehbehinderten Personen. Auf Grundlage des individuellen Unterstzützungsbedarfs des Schwerbehinderten kann eine Förderung für die Arbeitsassistenz beantragt werden. Der Arbeitgeber kann entscheiden, wer in seinem Betrieb als Arbeitsassistenz arbeiten darf.
- 10. Wo bekomme ich weitere Informationen?
Die Arbeitsagenturen und Jobcenter beraten Sie gern und unterstützen Sie bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Auch die Integrationsämter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.